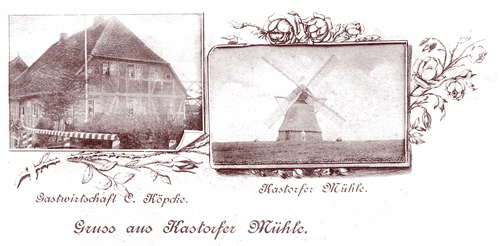Die Kastorfer Mühlen
Im Kastorfer Streit um die Landeshoheit von 1593 wird
noch ausdrücklich vermerkt, dass die Kastorfer nicht zur
Steinhorster Mühle zwangsverpflichtet sind, woraus man
schließen kann, das es hier noch keine Mühle gab. Bis zur
Umwandlung der Papiermühle 1685
werden die Kastorfer hauptsächlich die Brömbsenmühle in
Krummesse zum Kornmahlen genutzt haben.
Die Kastorfer Mühlengeschichte beginnt aber schon um 1630
unter dem Lübecker Bürgermeister
Gottschalk von Wickede. Dieser hatte das Gut Kastorf
1626 von seinem Vater geerbt und sah wie andere Lübsche
Gutsbesitzer die Chance durch Ansiedlung von Handwerk
außerhalb des Einflußbereichs der städtischen Zünfte
einträgliche Geschäfte zu machen.
Die Investitionen von Wickedes müssen jedenfalls
beträchtliche Ausmaße und einen starken Unternehmerwillen
gehabt haben, denn auf Kastorfer Grund gab es keine
natürliche Situation, die zur Anlage einer Wassermühle
geeignet gewesen wäre. So ließ er einen Verbindungsgraben
von fast einem Kilometer Länge, teilweise bis zu 8m tief
von der Göldenitz zur Wümmelken graben. Die Göldenitz
wurde im Karautschen Teich aufgestaut und versorgte nun
mit der Wümmelken den neuentstandenen Kastorfer Mühlenbach
und speiste so den Wümmelken Teich und den eigentlichen
Mühlenteich. So sorgten letztendlich drei Teiche für die
Wasserversorgung.
Wie auch später Nicolaus von Tode auf Rondeshagen, so lies
von Wickede eine Papiermühle erbauen. Da das Gutsarchiv
nur noch fragmentarisch vorhanden ist und die Siebenbäumer
Kirchenbücher bis 1791 völlig fehlen, gibt es über die
Papiermühle und Papiermacher kaum etwas zu berichten. Die
erste urkundliche Nennung der Kastorfer Papiermühle finden
wir in einer Lumpensammler-Verordnung aus dem Jahre 1636.
Darin wird gesagt, dass die Kastorfer Papiermühle ein
Geschirr (Stampfwerk) hat. Sie rechnet zu den fünf
Lübecker Papiermühlen und soll jeweils am Sonnabend in der
dritten Woche des Monats mit 350 Centner (ca. 17 t)
Lumpen beliefert werden. Die Papiermühle wird vermutlich
in Pacht an einen Papiermacher vergeben gewesen sein. Die
Pacht bestand meist aus einem vereinbarten Geldbetrag und
einer größeren Menge Papier (in Ries (1 Ries = 480 Bogen))
zum Selbstbedarf des Verpächters. Der erste Papiermacher
wird ein Jürgens
gewesen sein, der hier spätestens ab 1632 wirkte. Denn
sein Sohn Gottschalk wurde hier 1632 geboren und hatte
höchstwahrscheinlich den Gutsherrn als Paten. Gottschalk
Jürgens ertrinkt 14-jährig als Papiermacherlehrling 1646
in Siems.
Somit ist der 1640 im Siebenbäumer Kirchenrechnungsbuch
aufgelistete Papiermacher auch Jürgens. 1664 wird dann
noch einmal eine Papiermacherfrau von Kastorf im
Krummesser Kirchenbuch als Patin genannt. Bei ihr handelt
es sich vermutlich um die Wittwe Gertrude Wentorp deren
Mann, 1659 in Westerau verstarb.
1654 erhält Gottschalk von Wickede,
Erbgesessen auf Kastorf die kaiserliche Bestätigung der
Allodialgerechtigkeit zu der auch das Recht und die
Gerechtigkeit der Mühlen und Mühlen Lagen gehören.
1685 beschließen die Brüder von Wickede auf Kastorf und
Bliestorf, die unrentable Papiermühle in eine Kornmühle
umzuwandeln und die Bliestorfer und Kastorfer dahin
zwangszuverpflichten. Der Papiermüller, der noch die Pacht
schuldete, war mittlerweile heimlich geflohen. Vermutlich
wird hier wie auch im nahegelegenen Westerau und
Rondeshagen Rohstoffmangel (Lumpen) zu diesem Entschluss
geführt haben. Aber der Streit mit den Krummessser
Nachbarn kann ebenfalls ein Beweggrund gewesen sein.
Es liegt der Verdacht nahe, dass die Umwandlung aber
schon vor dem Vertrag von 1685 statt fand, denn aus einer
Akte zur Krummesser Mühle von 1680 geht hervor, dass ein
Labenzer Bauer auf dem Krummesser Mühlendamm angehalten
wurde und man ihm anriet „er solte umbkehren und nach der
Kastorfer Mühlen fahren“, oder war dies nur als ironischer
Witz gemeint?
Der erste Kornmüller wird Hans Hinrich(sen) (†
Krummesse 1701), Bruder des Grönauer Müller Hector Hinrichsen.
Vermutlich hat er den Umbau ausgeführt, da er 1691 auf die
Krummesser Bornmühle wechselt und die damalig übliche
Pachtdauer 6 Jahre betrug.
1686 wird er im Krummesser Kirchenbuch auch erstmals als
Kastorfer Müller gennant. Ihm folgt spätestens 1708 Claus Kron. Da es 1730
in einer Akte heisst: „wegen der Castorffer Kron Mühle“
dürfen wir wohl in diesem Müller den Namensgeber der Mühle
sehen.
1713 ist Friedrich
Schmidt Kastorfer Müller, der ab 1724 in Zecher
wieder zu finden ist. Aus dem Jahr 1721 ist uns ein
Rechtsstreit wegen „Verbalinjurien“ (Beleidigung) zwischen
Jacob Kempe aus Behlendorf, dem Ankläger, und dem
Kastorfer Müller Hans
Claasen überliefert. Müller Claasen war mit
seinem Gefährten, dem Ankerschen Müllerssohn [Hans Hinrich Averlin],
am Gründonnerstag oder Karfreitag 1721 in der Fleuth-Mühle
auf dem Mühlendamm in Lübeck erschienen. Dort, so bezeugte
es der Müllerbursche Hans
Jürgen Bahr, beleidigte er Berend Kempe bzw.
dessen Vater Jacob Kempe
und bezeichnete diesen als Pfuscher in der Annahme er sei
der Göldenitzer Müller. Die Sache ging an die Lübecker
Kämmerei und so auch an das Kastorfer Gericht. Müller
Claasen wurde darauf ebenfalls verhört und entschuldigte
sich für die nicht so gemeinten Äußerungen, wollte für die
schon entstandenen Unkosten aufkommen und erhielt noch
eine scharfe Verwarnung von seinem Gutsherrn Gotthard
Gottschalck von Wickede, womit die Sache erledigt war.
1724 finden wir Müller Clasen dann auf der Rondeshagener
Drögemühle wieder. Vermutlich ist er der Vater des
späteren Kastorfer Müllergesellen Anton Thomas Clausen,
(1743-1752) bzw. Krummesser Müllers.
Ihm folgt 1736 Bendix
Boye , ca. 1740 Carstens,
NN und 1744 Caspar
Lübke (auch Lübeck), vermutlich ein Sohn des
gleichnamigen Göldenitzer Müllers.
Um 1720 wird in Bliestorf eine neue Windmühle in Betrieb
genommen, die bei Wassermangel auch den Kastorfern dienen
soll. 1730 wird dann der Mühlenkontrakt von 1685 mit dem
Zusatz erweitert, dass, solange die Kastorfer noch keine
eigene Windmühle haben, sie auf der Bliestorfer Windmühle
mahlen dürfen.
Von 1750 bis 1757 ist Johann
Köpke als Kastorfer Müller nachzuweisen. Die
Pacht für die Wassermühle beträgt 1751 200 ML. Während
dieser Zeit sind aber auch noch Marcus Berend (1754;
identisch mit Marc Bahrt, 1721 RZ Sandmühle ?) und Siemen Boye (1756) als
solche genannt. Müller Johann Simon Boye hatte 1728 sein
Handwerk bei Müller Gottfried Kreutz auf der Ratzeburger
Sandmühle erlernt und steht im Oktober 1756 vorm Kastorfer
Gericht wegen Roggendiebstahls. Schon im Juli des selben
Jahres stand ebenfalls sein Zimmergeselle, Heinrich Ludwig
Diener aus Frankfurt/Main (33 J.) vor Gericht.
1751/52 läßt der neue Gutsherr, Christian
von Hammerstein Kastorf verkoppeln. Das wohl
ehemalige Angerdorf wird dabei in ein Straßendorf
umkonzipiert, es entstehen eine neue Hofanlage,
Aussiedlerhöfe und eine neue Windmühle auf halber Strecke
zwischen dem Gut und der Wassermühle. Diese Windmühle war,
wie der Kurhannoverschen Landesaufnahme von 1776 zu
entnehmen ist, noch eine Bockwindmühle. Von Hammerstein
hatte diese Windmühle allerdings ohne Konsens der
Regierung errichtet, wohl in dem Glauben, dass mit seiner
Mühlengerechtigkeit auch der Bau einer Windmühle
berechtigt sei. Doch das sah man in Hannover anders. Da es
aber keine klaren rechtlichen Grundlagen zum Mühlenbau im
Lauenburgischen gab und man diese Mühle in der Peripherie
des Herzogtums als "unschädlich" für die Amtsmühlen
erkannte, wurde der Bau nicht weiter beanstandet.
1758 wird dann nochmals der Zwang der Bliestorfer zur
Kastorfer Mühle geregelt und festgelegt.
Aus einer Statistik von 1766 geht hervor, das die
Kastorfer Mühle zu den „freien Höfen“ rechnete, d.h. dass
der Müller „dienstfrei“ also nicht zu Hofdiensten
herangezogen werden konnte.

"Castorffer Mühle" 1776, die Rote Linie kennzeichnet die
Grenze zu Bliestorf
1777 soll der Mehlbalken der Windmühle durch einen
Zimmermeister verstärkt. Kontukteur Anton Wilhelm Horst
(*Schwalberg 1714; † Ratzeburg 1789) bestätigt der Frau
von Hammerstein die Notwendigkeit.
1791 erfolgt eine Aufräumung des auch als Grenzscheide
zwischen Kastorf, Bliestorf und Rondeshagen gelegen
Mühlenbaches. 1794 ist Müller Nehls die Windmühlenwelle
eingebrochen.
Um 1800 wird nun direkt an der Bliestorfer Scheide neben
der Wassermühle ein neue Windmühle errichtet. Dieser mit
strohgedeckte Erdholländer wird wohl ein Bau des Müllers Christoph Brand
(s.a. Rondeshagen, Siebenbäumen) gewesen sein. Dieser sehr
rührige Müller heiratet 1792 Sophia Sauer, Tochter des
benachbarten Zolleinnehmers Hermann Sauer. Brand
ist bis 1799 in Kastorf als Müller. Während dieser Zeit
findet sich aber auch noch Johann Neels, der hier
zwischen 1793 bis 1795 ebenfalls Müller ist.
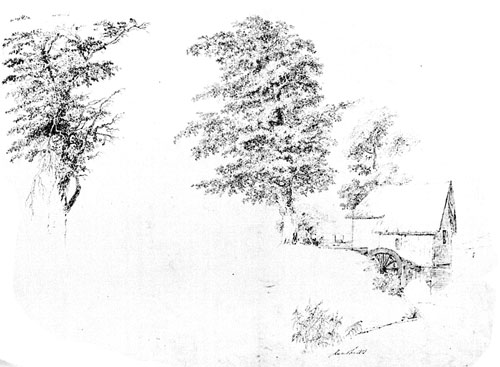
Die Kastorfer Wassermühle gezeichnet von C.F. von Rumohr
1812
1799 haben wir es dann gleich mit zwei Müllern zu tun.
Erstens mit Caspar Scheel,
der 1798 noch als Pensionär bezeichnet wird und 1 Jahr
später auch Pächter von Göldenitzer Weeden ist. Und
zweitens mit David
Niemann, der hier auch nur kurz Müller gewesen
sein kann, denn 1803 ist er schon auf der Neritzer Mühle
bei Bad Oldesloe. Um dem Wechselspiel noch einen oben
drauf zu setzen, taucht dann noch 1800 Johann Petersen von der
Schulenburger Mühle als Kastorfer Müller auf. Dieser
verkauft die Mühle aber schon kurz darauf 1802 an den
Mühlenmeister Johann
David Leverenz, aus Holm/Meckl.. Müller Leverenz
ist ein Sohn des Voigtshagener Müllers Dietrich Gottfried
Leverenz und wird 1779 in das Grevesmühlener Mülleramt
aufgenommen in dem er bis zu seinem Verschwinden 1816 auch
bleibt. Von 1779 bis mindestens 1798 ist er Müller in Groß
Voigtshagen/Meckl..
In dem Kaufvertrag heisst es im §1: ...1) die anstatt der
hirbevorigen Erbpacht-Windmühle neu erbaute, und daher
als Erbpachts-Windmühle wiederum eingetretenen Windmühle
und die Wassermühle nebst der Staubmühle, der
Grütz-Querre, den Sichtträgen und vier Seegeln...
6)... der in der
Holzkoppel der Redder, genannt belegene vormals
begrabene Platz, worauf die alte Windmühle gestanden,
als welchen hierfür der Mühlenmeister Peters uhnlängst
wieder käuflich an den Herrn Baron von Hammerstein
überlassen hat...
Zwar ist die Flurbezeichnung Holzkoppel nicht mehr in der
Katasterkarte von 1877 zu finden, aber Dank der
Kurhannoverschen Landesaufnahme von 1776 kann dieser
Standort auf halber Strecke zwischen dem Zolln und dem Gut
ausgemacht werden.
Über alle die obigermaßen
gedachten Grundstücke ist von dem Herrn Lieutnant P.A.
Kölzenberg im Jahr 1799 eine Charte und Vermeßregister
entworfen, welche neben diesem Contrakte dem Käufer
überliefert wird. ... Es folgt der
Erbpacht-Contrakt.
1803 verunglückt Heinrich
Stadtländer tötlich. Er wollte unter der
Windmühle hindurchgehen und wird von einem Flügel
getroffen. Kurz darauf erliegt seinen Verletzungen.
1806 wird Kastorf von den Truppen Napoleons geplündert.
Der benachbarte Wegegeldeinnehmer Sauer macht eine genaue
Aufstellung der entwendeten Dinge. So das anzunehmen ist,
das auch Müller Leverenz nicht ungeschoren davon gekommen
sein wird.
Müller Leverenz kann seine Wassermühle oft wegen
Wassermangel nicht betreiben. Der Grund dafür sind seiner
Meinung nach durch Baron von Hammerstein wohl neugezogene
Gräben, die dem Mühlenbach im wahrsten Sinne das Wasser
abgegraben haben. Aber eine unabhängige Kommission
bestehend aus Amtmann Compe und Commissair Ziegler stellt
1807 fest, dass es nicht an dem ist. Doch von Hammerstein
wird dazu verurteilt die Wasserleitung wieder
herzustellen. Nebenbei erfahren wir aus dieser Akte, dass
die Wassermühle ein oberschlächtiges Rad hatte.
1808 gerät Müller Leverenz in Rückstand mit seinen
Pachtzahlungen, so dass 1809 der Kastorfer Gutsherr von
Hammerstein gegen den Müller wegen nicht bezahlter Pacht
klagt. Müller Leverenz ist verpflichtet halbjährlich eine
Pacht von 62 Rthl. zu zahlen, doch die Zeiten sind
schlecht, die französische Besatzung laugt das Land aus
und Leverenz sieht nur einen Ausweg im Verkauf des
Mühlenanwesens.
Hannoversche
Anzeigen 3 April 1809
Adelich Gericht Castorf.
Demnach der Erbpachtsmüller Leverenz zu Castorf nicht
nur mit seinen Mühlenerbpachtgeldern in Rückstand
geblieben ist, sondern auch angezeiget hat, daß er nicht
bezahlen könne; wie dem auch von demselben darauf
angetragen ist, seine Mühle zurückzunehmen; so ist zum
öffentlich meistbietenden Verkauf dieser Wind- und
Wassermühlen, welche zu Castorf, an der Landstraße,
zwischen Lübeck und Hamburg belegen sind, und wobei nach
dem Vermeß-Register, 3873 QR an Grundstücken befindlich
seyn sollen, nach zu Grundlegung des darüber bestehenden
Erbpacht-Contrakts, und der weiter festzusetzenden
Bedingungen Termin auf den 19ten April d.J. Vormittags
um 11 Uhr angesetzt, und können zu dem Ende sich die
Kaufliebhaber zur bestimmten Zeit auf dem Hofe zu
Castorf einfinden, wo selbst auch bei dem Herrn
Actuarius Hering der Erbpachts-Contrakt und die nähern
Bedingungen anzusetzen sind: so wie der Förster Decken
den Auftrag hat die Grundstücke nachzuweisen. Auch
werden diejenigen, welche berregte Wind- und
Wassermühlen mit Zubehör, es sey aus welchem Grunde es
wolle, hiermit peremtorie vorgeladen. Auswärtige unter
Bestellung eines Procuratoris ad acta, mit
abschriftlicher Zurücklassung ihrer in Händen habenden,
die Forderung betreffenden Documente, binnen 12 Wochen a
dato bei mir Unterschriebenen, oder bei dem Hrn.
Actuarius Hering zu Castorf genau anzugeben, unter der
Verwarnung, daß sie widrigenfalls mit ihren Forderungen
an berregte Mühlen und Zubehör werden präcludirt, und
davon auf immer werden abgewiesen werden. Decretum im
adelichen Gerichte Castorf den 20ten März 1809.
Schnorr, Dr. p.t.
Justitiarius.
1812 wird vor dem Lübecker Tribunal Gericht ( I. Instanz)
die Klage des Gutsherrn und Eigners der Kastorfer Mühle
Christian von Hammerstein wegen ausgebliebener Pacht gegen
den Müller Johann David
Leverenz verhandelt. Letztendlich wird Müller
Leverenz Klage abgewiesen und er muss die Kosten des
Rechtsstreits übernehmen. Doch zur Herstellung der
Wasserleitung ist es bisher nicht gekommen, von
Hammerstein meldet 1813 Konkurs an, so dass jetzt die
Curatoren in der Verantwortung stehen. 1816 beginnt nun
tatsächlich die Wiederherstellung der Wasserleitung. Doch
der benachbarte Zolleinnehmer Sauer zeigt beim Ratzeburger
Hofgericht an, wenn die Arbeiten fortdauren und der
Müller nicht vorher das schon verfallene Grundwerk und den
Ablaufgraben wieder mache, würde sein Wohn- und Brauhaus
mit Wasser überschwemmt. Auch ist Müller Leverenz
nicht bereit die Wasserleitung auf seinem eigenen Grund
wieder herzustellen.
1815 werden dem Müller Johann David Leverenz zwei Pferde
aus dem Stall gestohlen. Müller Leverenz macht 1816 (?)
Konkurs und flieht aus Kastorf, so dass die Mühle wieder
an das Gut fällt.
Ab 1809 ist ebenfalls Müller Ludwig Leverenz als
Pächter aktenkundig. Er wird auch als 1/4-Hufner
bezeichnet und bleibt hier ebenfalls bis 1816. 1810 leben
in seinem Haushalt neben seiner Frau, der Magd Benthin,
ein Geselle namens Huntermann.
1812 gehören zur Mühle: Mühlenhaus 8 Ruthen, Hof und
Garten 112 Ruthen, Ackerland 24 Morgen, Wiesen und Weiden
5 Morgen (Mühlenkoppel, Erbenzins, Graskoppel).
So ist 1817 der Mühlenbach immer noch nicht aufgeräumt
noch das Grundwerk wieder hergestellt. Was zwischen 1817
bis 1827 geschieht, läßt sich aus den Akten nicht
erschließen. Vermutlich wird die Mühle vom Rondeshagener
Müller Martin Friedrich
Ahlers, der ab 1827 in Kastorf nachzuweisen ist
ab 1824 mitbewirtschaftet. 1829 wird der folgende
Mühlenpächter Möller
zu Kastorf vom Bliestorfer Gutsgericht beschuldigt Bretter
von der Ziegeleischeune zu Bliestorf, die gleich nebenan
liegt, entwendet zu haben. Auch wird ihm vorgeworfen, das
er unbefugt auf Bliestorfer Gebiet gefischt habe.
Anton Christian Dietrich
Sauer kauft mit Vertrag vom 11. Mai 1831 die
Kastorfer Mühle. Es wird eine Erbpachtsumme von 80 Rthl.
jährlich ausgemacht. Sein Urgroßvater besaß schon seit
1730 die benachbarte Hofstelle, das Brantweinhaus oder
auch Kastorfer Zolln genannt und war wie Anton auch
Wegegeldeinnehmer an der hiesigen Zollstelle der
Hamburg-Lübecker-Frachtstraße. Anton ist 1812 als Besitzer
der Hofstelle (Zollen) nachgewiesen, die Mühlenhofstelle
hat zu dieser Zeit noch der Müller Ludwig Leverenz in
Erbpacht.
1842 wird Anton Sauers
Frau Wilhelmine Magdalene
geborne Karsten als Patin in Behlendorf bei der
Taufe ihrer Nichte, der Müllerstochter Oltmann genannt.
1845 wird Anton in der Volkszählungsliste als
Wegegeldeinnehmer, Hufner und Müller aufgeführt. Seinen
Bruder, Peter Friedrich Christoph finden wir 1830 als
Pächter auf der Labenzer Mühle, später als Mühleneigner in
Behlendorf. Da Anton 1784 geboren, somit 1845 schon 59
Jahre alt ist, läßt er die Mühlen vermutlich durch
Gesellen wie Friedrich
Severin und Julius
Blüher (1853) bewirtschaften.
Die Kastorfer Wassermühle wird vermultich von Anfang an
unter Wassermangel gelitten haben, doch die Trockenlegung
des Teiches in der Kahnschen Wiese, sowie des Wümmelken
Teiches um 1800, haben den weiteren Betrieb schwer
geschädigt. 1844/1852 ist nur noch der Mühlenteich
gestaut. 1855 scheint die Wassermühle nicht mehr in
Betrieb, denn sie wird in der Mühlenkarte aus dem selben
Jahr nicht mehr aufgeführt.
Als 1862 der Müller Sauer verstirbt scheinen die Erben,
die beiden Hofstellen und den Einnehmerposten an Carl
Heinrich Köpke aus Mecklenburg verkauft zu haben. Dazu:
Wöchentliche
Anzeigen des Fürstenthums Ratzeburg 10.April 1863
Mühlenverpachtung.
Es soll die zu Castorf
belegene Kornmühle auf 6 nacheinander folgende Jahre von
Maitag d. J. an öffentlich meistbietend verpachtet
werden, und werden deßhalb Pachtliebhaber geladen, sich
am Dienstag den 21. April d. J., Vormittags 11 Uhr, in
der Wohnung des unterzeichneten Gerichtshalters in der
Stadt Ratzeburg einzufinden.
Die Pachtbedingungen
können ebendaselbst und auf dem Herrenhofe Castorf vom
11. April an eingesehen werden.
Gericht Castorf,
Ratzeburg den 29. März 1863. Sachau.
Müller Carl Heinrich
Ludwig Köpke stammt aus Bantin in Mecklenburg und
ist verheiratet mit Maria Caroline Friedericke geborene
Röhr aus Klein Parin. Müller Köpke läßt 1864 einen
Lehrburschen, Carl Georg
Ludwig Behrens, in die Ratzeburger
Mülleramtsrolle eintragen und ist damit wohl auch der
Käufer 1863. 1869 stellt er den Kastorfer Heinrich Klafak als
Lehrling ein. 1867 findet sich dann ein Müller Christian Wischendorf
auf der Mühle. Dieser scheint aber die Mühle schon im
selben Jahr wieder zu verlassen und ist dann auf der
Schleemer (HH-Billstedt) Färbeholz-Windmühle zu finden.
1879 bewirbt sich Müller Köpke um die Pachtung der Aumühle
unter Fürst Bismark, wird aber vom Dassendorfer Müller
Wilcken überboten.
Müller Köpke ist bis 1905 als Müller und Krüger in
Kastorf. Die Mühle selbst ist nach wie vor in
gutsherrlicher Hand und nur in Pacht vergeben. Ihm wird
1886 offiziell die Schankgerechtigkeit von Amtswegen
zugestanden. 1880 zählen 7 Männer, 4 Frauen und 2
vorübergehend hier lebende Personen (wohl Gesellen) zum
Haushalt von Müller Köpke. Er stirbt 1906 in Bliestorf.
1905 pachtet der aus Wittenburg stammende Obermüller
Johann Elvers die
Mühle auf 10 Jahre. Außer der Müllerei und der Bäckerei
möchte er, wie auch seine Vorgänger, eine Gastwirtschaft
betreiben und beantragt deshalb schon vor Pachtantritt
1904 eine Konzession beim Amt. Er begründet seinen Antrag
damit, dass in dem dortigen Mühlengebäude das Gastrecht
schon seit „unerdenklicher Zeit bestanden“ habe, schon
sein Vorgänger C. Köpke wie auch der Mühlenmeister Sauer
hätten schon eine Gastwirtschaft dort betrieben. Müller
Elvers wird 1907 durch Mülergeselle Wilhelm Ebell und ab
1910 durch Müllergeselle Ludwig
Eggert unterstützt.
Müller Elvers hatte eine Tochter Paula (*1904) die später
nach Schlagsdorf/Meckl. ging. Dies war eine Spielkameradin
meiner im selben Jahr geborenen Großmutter, Elsa Büsing,
geb. Tews, die sich noch gut daran erinnern konnte, dass
es hier bei Elvers "immer ein Stück Kuchen extra gab".
Die Windmühle wird 1914 kurz vorm 1. Weltkrieg
abgebrochen.